Telemedizin in der HNO-Praxis: In 5 Schritten zur Videosprechstunde
Die Nachfrage nach Videosprechstunden steigt – auch in HNO-Praxen. Viele Beschwerden lassen sich bereits im Videokontakt zuverlässig einschätzen, und Patient*innen schätzen die Flexibilität. Doch wie gelingt der Einstieg in die Telemedizin konkret? Dieser Beitrag zeigt, wie Sie in fünf Schritten eine Videosprechstunde effizient und praxisnah etablieren – von der Anbieterauswahl bis zur Abrechnung.
1. Anbieter auswählen: Welches System passt zu Ihrer Praxis?
Die Wahl des richtigen Videodienstanbieters ist der erste und wichtigste Schritt. Entscheidend sind neben der KBV-Zertifizierung auch Aspekte wie Bedienbarkeit, Funktionsumfang und Integration in den Praxisablauf.
Grundsätzlich lassen sich zwei Anbieterarten unterscheiden:
- Softwareanbieter: Die Videosprechstunde wird als eigenständige Anwendung oder als Modul innerhalb des Praxisverwaltungssystems (PVS) genutzt – entweder integriert oder unabhängig. Diese Lösung eignet sich besonders für Praxen, die ihre Patient*innen selbst terminieren und die Videosprechstunde in ihren regulären Praxisbetrieb einbinden möchten. Zu den verbreiteten Anbietern zählen beispielsweise CGM CLICKDOC, ein klassisches, PVS-integrierbares Videotool, oder arztkonsultation.de, das unabhängig vom PVS funktioniert und eine besonders intuitive Bedienung bietet.
- Plattformanbieter: Hier registrieren sich Ärzt*innen auf einer externen Plattform und bekommen Patient*innen über das Portal vermittelt. Für viele HNO-Praxen ist das eine attraktive Ergänzung, um z. B. außerhalb der regulären Sprechzeiten digitale Beratungen durchzuführen. Ein häufig genutzter Anbieter in diesem Bereich ist Teleclinic – eine externe Pattformlösung mit hoher Reichweite. Erfahrungen aus dem HNOnet, unter anderem von Dr. Uso Walter, zeigen, dass sich Teleclinic besonders gut für videobasierte Verlaufskontrollen und Therapiebegleitung im HNO-Alltag eignet.
Tipp: Überlegen Sie, ob Ihre Praxis ein schlankes Tool für eigene Patient*innen sucht – oder eine Plattformlösung mit erweiterten Services und Reichweite sinnvoll ist. Die vollständige Liste zertifizierter Anbieter finden Sie bei der KBV.
Was kostet die Videosprechstunde?
Die Kostenstruktur hängt stark vom gewählten Anbieter ab. Bei Plattformlösungen wie Teleclinic fallen für Ärzt*innen keine fixen Kosten an – stattdessen übernimmt die Plattform die Patientenakquise und erhält einen Anteil am Honorar. Anders sieht es bei Softwareanbietern aus: Hier richten sich die monatlichen oder nutzungsabhängigen Gebühren meist nach dem Funktionsumfang und der Anzahl durchgeführter Videosprechstunden. Einige Anbieter bieten Paketpreise oder Flatrates, andere rechnen pro Sitzung ab.
Prüfen Sie vor Vertragsabschluss, welche Leistungen im Paket enthalten sind – etwa Support, Zusatzmodule oder Nutzerkonten – und ob zusätzliche Kosten entstehen.
2. Technik bereitstellen – so läuft die Telemedizin stabil
Die technische Ausstattung muss zuverlässig sein, damit die Videosprechstunde sowohl für Sie als auch für Patient*innen stressfrei funktioniert.
Sie brauchen:
- eine stabile Internetverbindung (mind. 10 Mbit/s Upload empfohlen)
- eine Webcam mit guter Audio- und Bildqualität
- einen Computer oder Laptop mit ausreichend großem Bildschirm, damit Befunde und Bildmaterial gut sichtbar sind
- einen geschlossenen Raum zur Sicherstellung der Vertraulichkeit
Tipp: Viele Praxen richten ein separates „Videosprechzimmer“ ein, alternativ funktioniert es mit Laptop im ruhigen Büro.
3. Von Anzeige bis Abrechnung: So wird die Videosprechstunde KV-konform
Bevor Sie die Videosprechstunde in Ihrer Praxis abrechnen können, sollten Sie bei Ihrer Kassenärztlichen Vereinigung (KV) klären, ob eine Anzeige oder eine Genehmigung des genutzten KBV-zertifizierten Videodienstanbieters erforderlich ist. In vielen Regionen genügt eine formlose Anzeige – meist über das Mitgliederportal oder ein Formular. Andere KVen verlangen eine explizite Genehmigung.
Voraussetzung für die Abrechnung ist in jedem Fall die Einhaltung der technischen und datenschutzrechtlichen Anforderungen – insbesondere die Nutzung eines KBV-zertifizierten Anbieters.
Abrechnungsrelevante GOPs:
- 01444 – Fachärztliche Videosprechstunde
- 01450 – Technikzuschlag
- Weitere Leistungen (z. B. Gesprächsleistungen) nach EBM-Kapitel 1.4
Tipp: Die Videosprechstunde unterliegt meist einer Budgetierung. Informieren Sie sich daher bei Ihrer KV über spezifische Mengenbegrenzungen oder Kombinationsvorgaben.
Zusätzlich lassen sich ergänzende Wahlleistungen auf GOÄ-Basis integrieren – etwa bei Beratungen zu konservativen Therapien oder für privat Versicherte.
4. Patient*innen aufklären: Transparenz schafft Vertrauen
Vor der ersten Videosprechstunde sollten Patient*innen über Ablauf, technische Voraussetzungen und Datenschutz informiert werden. Die meisten Anbieter und Plattformen stellen hierfür Einwilligungsformulare zur Verfügung.
Weisen Sie darauf hin, dass die Verbindung Ende-zu-Ende-verschlüsselt ist und keine Aufzeichnung erfolgt und machen Sie transparent, dass bei Bedarf ein Präsenztermin nötig sein kann, z.B. für eine körperliche Untersuchung.
Der Zugang erfolgt in der Regel per Link oder QR-Code. Hinweise auf das Angebot – z. B. auf der Website, im Wartezimmer oder am Telefon – erhöhen die Akzeptanz.
5. Integration in den HNO-Praxisalltag
Videosprechstunden funktionieren am besten, wenn sie feste Zeitfenster im Praxisablauf haben – zum Beispiel für Verlaufskontrollen bei Rhinosinusitis oder Tinnitus, sowie für Befundbesprechungen. Das sorgt für mehr Planbarkeit und entlastet die Präsenzsprechstunde. Prüfen Sie zudem, ob sich bestimmte Leistungen dauerhaft gut per Video anbieten lassen – etwa die Nachbesprechung von CT- oder MRT-Befunden, die Beratung bei Schwindel oder die Diskussion konservativer Therapien.
Tipp: Seit Juli 2025 ist auch die Verordnung von Hilfsmitteln, wie z. B. Inhalationsgeräte oder Verbandmittel, per Videosprechstunde möglich – wenn keine körperliche Untersuchung erforderlich ist.
Rechtlicher Rahmen ab September 2025: Was ist erlaubt?
Die rechtlichen Rahmenbedingungen wurden zuletzt präzisiert. Ab September 2025 gelten laut Bundesärztekammer und GKV-Spitzenverband folgende Anforderungen:
- Behandlung darf nur aus Deutschland und in geeigneten, geschlossenen Räumen mit Zugriff auf die Praxisdaten erfolgen.
- Patient*innen dürfen nur in einem räumlichen Umkreis von max. 2 Stunden Entfernung behandelt werden.
- Bei Bedarf muss eine Anschlussbehandlung vor Ort möglich sein.
- Vermittlungsportale müssen Anfragen nach Dringlichkeit und nicht nach Honorarhöhe priorisieren.
- Vor der Vergabe eines Termins für eine Videosprechstunde muss ein Ersteinschätzungsverfahren durchgeführt werden, um zu prüfen, ob eine Videosprechstunde medizinisch geeignet ist.
- Maximal dürfen 50 % aller Behandlungsfälle mit bekannten Patient*innen per Videosprechstunde versorgt werden. Bei unbekannten Patient*innen sind bis zu 30 % aller abgerechneten Fälle per Video erlaubt. Als bekannt gelten Patient*innen, die in den vorhergehenden drei Quartalen einen persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt hatten.
Fazit: Telemedizin sinnvoll in die HNO-Praxis integrieren
Die Videosprechstunde entfaltet ihr Potenzial besonders dann, wenn sie durchdacht in den HNO-Praxisalltag eingebunden ist: Ein zertifizierter Anbieter, verlässliche Technik, strukturierte Abläufe und transparente Kommunikation mit den Patient*innen sind entscheidend. Richtig umgesetzt ist sie nicht nur ein modernes Serviceangebot, sondern auch wirtschaftlich interessant – insbesondere für Verlaufskontrollen, Beratungen und ergänzende Wahlleistungen. Für komplexe Diagnostik und körperliche Untersuchungen bleibt der persönliche Kontakt aber weiterhin unerlässlich.
Praxisbeispiel gesucht? Weitere wertvolle Erfahrungswerte von Dr. Uso Walter finden HNOnet-Mitglieder in der Ausgabe 04/2024 der HNOnet-Nachrichten!
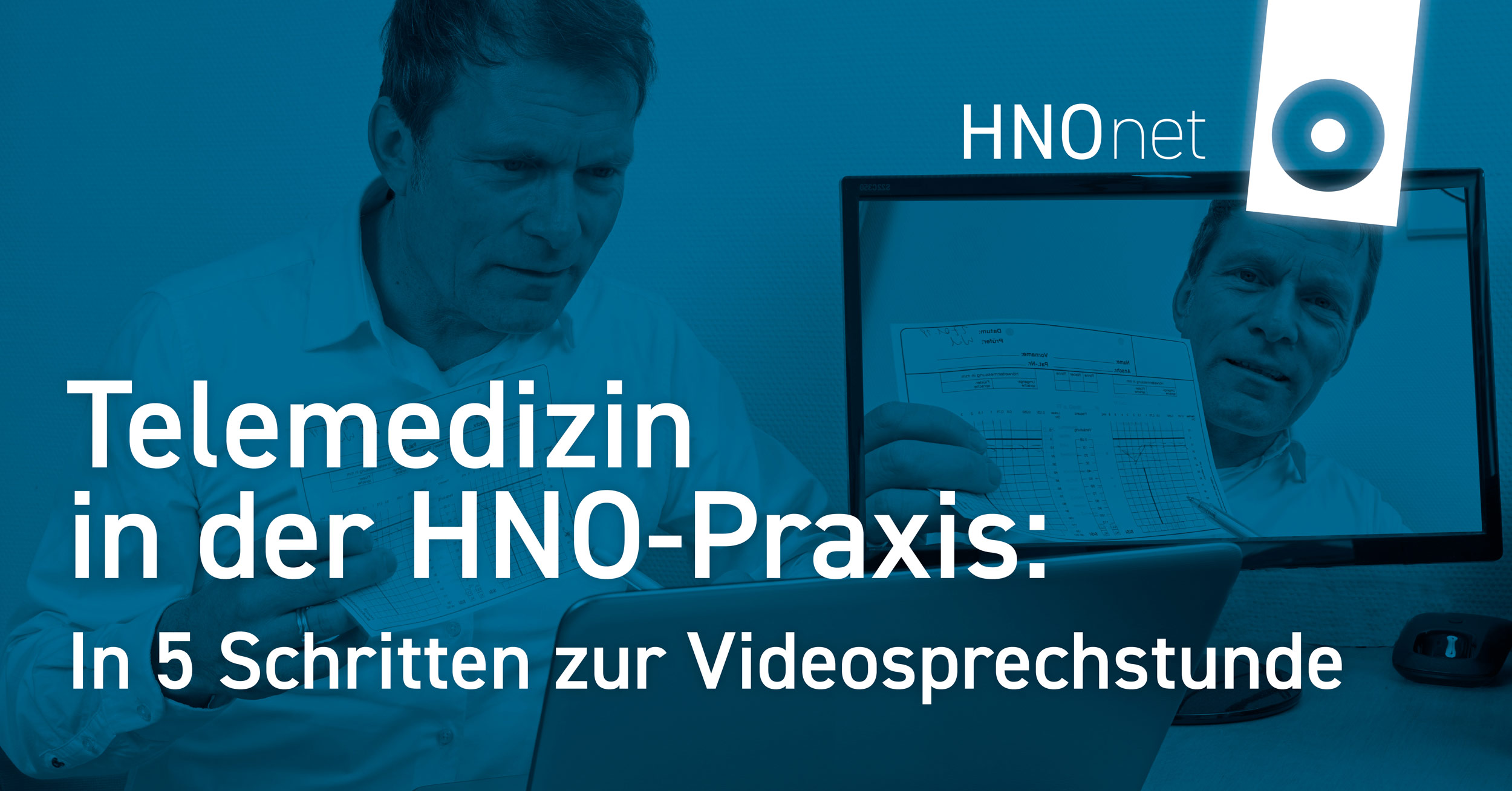
Mehr Nachrichten:
Kartentausch & Konnektortausch: Telematikinfrastruktur einfach erklärt (FAQ)
HNOnet
c/o Frielingsdorf Consult GmbH
Hohenstaufenring 48-54
50674 Köln
-
(0221) 13 98 36 - 69
-
(0221) 13 98 36 - 65