Hyperakusis – ein unterschätztes Phänomen
Über 500.000 Menschen in Deutschland sind von behandlungsbedürftiger Hyperakusis betroffen, vermutlich sind es aber noch wesentlich mehr. Denn häufig wird die Geräuschüberempfindlichkeit, beispielsweise durch die Kombination mit Tinnitus-Beschwerden, nicht erkannt. In der Differenzierung liegt die Herausforderung – sowohl in der Forschung als auch in der Praxis. Was können HNO-Ärzt*innen tun?
Bis vor 20 Jahren kam der Hyperakusis in der Behandlung kaum eine Bedeutung zu. Auch heute wird Hyperakusis im ICD nicht gesondert aufgeführt und als Begleitung von Tinnitus oder anderen Erkrankungen häufig nicht erkannt. Dabei sind alleine etwa 40 Prozent der Tinnitus-Betroffenen auch von Geräuschüberempfindlichkeit betroffen. Aber eine Geräuschüberempfindlichkeit kann auch als eigenständiges Symptom auftreten. Forscher*innen der Universität Antwerpen gehen davon aus, dass Patient*innen mit Hyperakusis ohne Tinnitus-Beschwerden zwar einer Minderheit angehören, dafür möglicherweise unterdiagnostiziert und entsprechend auch nicht behandelt werden. Dabei leiden auch jene Betroffenen zum Teil unter einer deutlichen Einschränkung der Lebensqualität.
Bei Hyperakusis empfinden Betroffene selbst normale Umgebungsgeräusche als sehr unangenehm. Sie reagieren auf harmlose Alltagsgeräusche, zum Beispiel Türquietschen, mit starken Reaktionen wie Schweißausbrüchen oder Herzrasen. Folgen sind psychische Belastung, sozialer Rückzug, Schlafprobleme, Konzentrationsschwierigkeiten oder gar Depression. Die Geräuschüberempfindlichkeit führt häufig dazu, dass Betroffene bestimmte Situationen aus Angst vermeiden und sich dadurch wiederum die Empfindlichkeit verstärkt. HNO-Ärzt*innen können helfen, diesen Kreislauf zu durchbrechen.
Doch durch welche Diagnostik kann Hyperakusis klar identifiziert werden? In der Diagnostik von Hyperakusis spielen sowohl audiologische Befunde als auch anamnestische Angaben eine Rolle. So findet man häufig eine beginnende Schwerhörigkeit im Audiogramm und die Unbehaglichkeitsschwelle liegt unter 80 Dezibel.
Ursächlich für die Hyperakusis ist eine gestörte Hörverarbeitung, die Störgeräusche nicht mehr ausreichend filtert. Diese entsteht entweder kompensatorisch bei einem Hörverlust, was auch der Grund dafür ist, dass viele ältere Patient*innen unter einer Geräuschempfindlichkeit leiden, oder durch Stress. Da die Hyperakusis selbst auch wieder zu Stressreaktionen führt, entsteht hier schnell ein Teufelskreis.
Bei Hyperakusis handelt es sich um ein funktionelles Problem. Daher bekommt man sie in der Regel durch einfaches Hörtraining im Sinne einer akustischen Hyposensibilisierungsbehandlung wieder in den Griff. Im Mitgliederbereich bieten wir hierzu Trainingsanleitungen an, die Patient*innen mitgegeben werden können.
Abzugrenzen von der Hyperakusis sind die Phonophobie, eine Überreaktion des vegetativen Nervensystems auf bestimmte Geräusche, und die Misophonie, eine übermäßig starke emotionale Reaktion auf Geräusche wie Schmatzen oder Kauen. Hier sollte eine psychosomatische bzw. psychotherapeutische Untersuchung in Betracht gezogen werden.
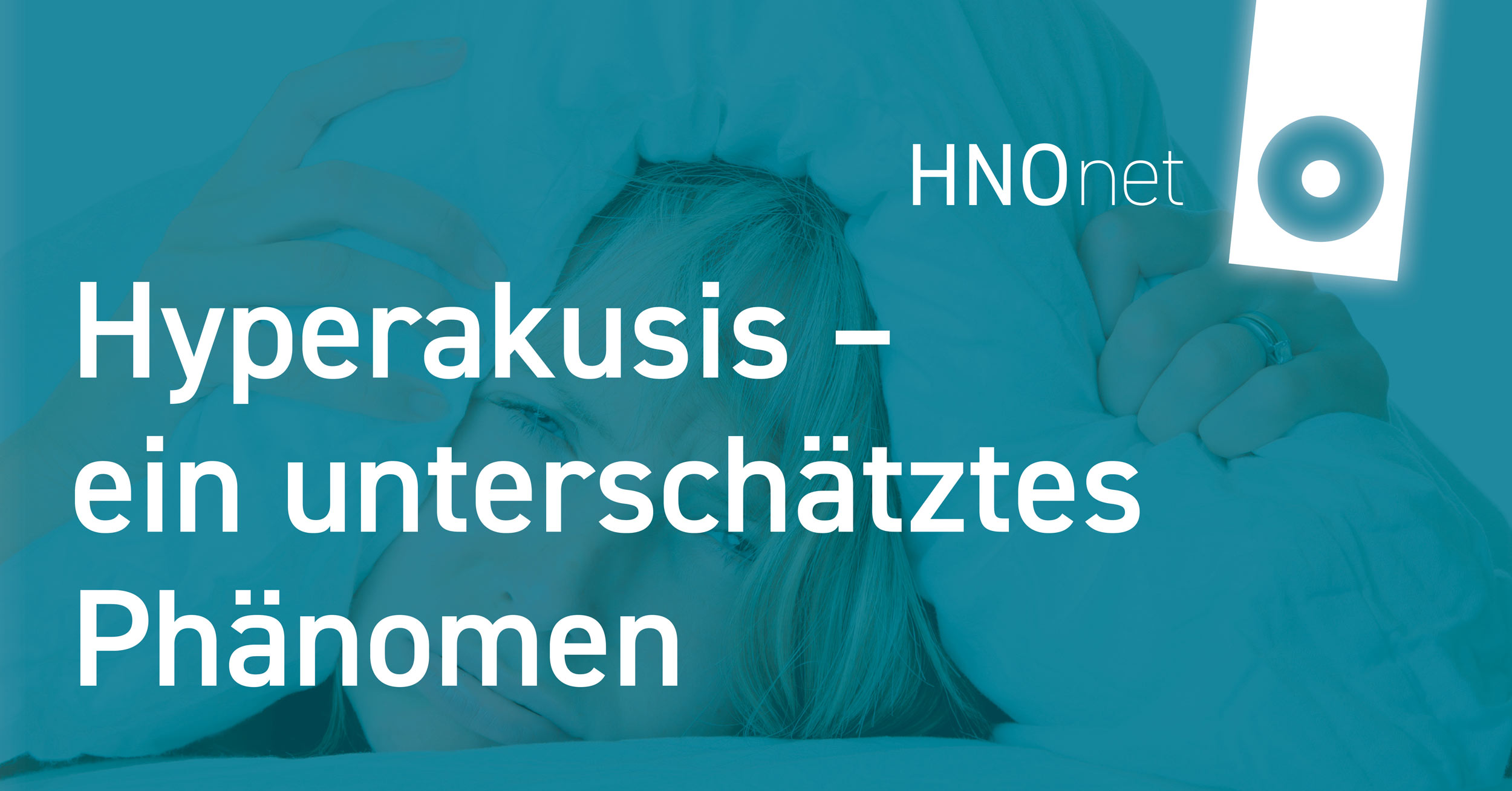
Mehr Nachrichten:
Kartentausch & Konnektortausch: Telematikinfrastruktur einfach erklärt (FAQ)
HNOnet
c/o Frielingsdorf Consult GmbH
Hohenstaufenring 48-54
50674 Köln
-
(0221) 13 98 36 - 69
-
(0221) 13 98 36 - 65